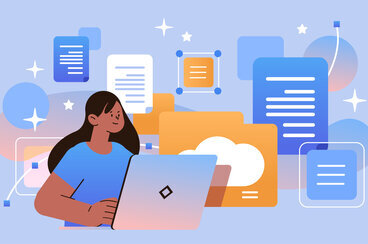Mamma Mia › Gebärmutterkrebs › Interdisziplinäres Behandlungsteam und Tumorboard bei Krebs
Ein interdisziplinäres oder multidisziplinäres Behandlungsteam setzt sich aus Fachleuten aus der Medizin und verschiedenen Gesundheitsberufen zusammen. Es kommt an vielen Kliniken zum Einsatz, wenn Krebserkrankungen wie Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom) behandelt werden sollen. Beispiele sind zertifizierte Krebszentren und onkologische Spitzenzentren (Comprehensive Cancer Center oder CCC).
Das Wort „interdisziplinär“ bedeutet, dass Spezialistinnen und Spezialisten verschiedener medizinischer Fachrichtungen Hand in Hand arbeiten. Sie bringen spezielles Fachwissen und viel Erfahrung in der Diagnostik und Therapie einer Krebsart mit. Auch Angehörige anderer Professionen und Gesundheitsberufe, zum Beispiel aus der Psychoonkologie, Krankenpflege oder Sozialarbeit, sind bei Krebserkrankungen ein wesentlicher Teil des interdisziplinären Teams.
Interdisziplinäres Netzwerk aus medizinischen Fachkräften
Alle Teammitglieder bilden ein engmaschiges Netzwerk. Sie tauschen sich regelmäßig untereinander aus und bringen einander auf den neuesten Stand. Dies geschieht im Rahmen von regelmäßigen Tumorkonferenzen oder Tumorboards.
Das Team plant Ihre Krebstherapie individuell und berücksichtigt dabei viele Einflussfaktoren. Beispiele: Ihr Alter, Ihren allgemeinen Gesundheitszustand, die Art, das Stadium und die Aggressivität Ihrer Krebserkrankung, aber auch Ihren sozialen Hintergrund. Jedes Teammitglied trägt also einen „Baustein“ oder ein „Puzzleteil“ zu einem individuellen Krankheitsfall bei.
Ziel ist, für einen Menschen mit einer Krebserkrankung die bestmögliche Behandlung nach neuesten medizinischen Standards zu finden. Die vorgeschlagene Therapie richtet sich in der Regel nach den medizinischen Leitlinien, die es für viele Erkrankungen gibt, auch für Gebärmutterkrebs. Die Leitlinien umfassen medizinische Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie einer Krankheit. Ärztinnen und Ärzten dienen sie als Orientierung, sie sind aber nicht verpflichtend.
Warum interdisziplinäre Teams bei Krebs?
Bei der Behandlung von Krebserkrankungen gibt es oft rasante Fortschritte. So wurden zum Beispiel zielgerichtete Medikamente (targeted therapy) entwickelt, die Krebszellen an bestimmten „Achillesfersen“ angreifen können. Ein Beispiel sind sogenannte PARP-Hemmer. Diese Medikamente kommen unter bestimmten Voraussetzungen bei Gebärmutterkrebs und auch bei einigen anderen Krebsarten zum Einsatz. Auch die Immuntherapie – ebenfalls für verschiedene Krebsarten – ist eine noch vergleichsweise „junge“ Möglichkeit der Krebstherapie. Sie richtet sich nicht direkt gegen Krebszellen, sondern aktiviert das Immunsystem, welches die Krebszellen dann bekämpft.
Neuerungen gibt es auch in der Diagnostik von Krebserkrankungen. So werden heute Krebszellen viel genauer auf ihre molekulargenetischen Merkmale hin untersucht. Ziel ist es, maßgeschneiderte Therapien zu finden, die sich wiederum gegen diese besonderen Eigenschaften von Krebszellen richten.
Einzelne Ärztinnen und Ärzte können kaum sämtliche Neuerungen bei den Therapien und Diagnosemethoden einer Krebserkrankung überblicken. Die Diagnostik und Behandlung von Krebs ist eine große Herausforderung, die sich besser im Team meistern lässt. Daher zählen die Gemeinschaft und das Miteinander!
Patientinnen und Patienten mit Krebs profitieren von der Behandlung durch ein interdisziplinäres Team. Sie müssen nicht nacheinander verschiedene Fachärztinnen und Fachärzte aufsuchen, sondern unterschiedliche Fachleute betreuen und behandeln sie von Beginn an aus einer Hand.
Bei der Therapie von Gebärmutterkrebs setzt sich das interdisziplinäre Behandlungsteam unter anderem aus Fachleuten der folgenden Fachgebiete zusammen:
|
Fachgebiet |
Aufgaben |
||
|
Pathologie |
Analyse von Gewebe, Ermittlung besonderer Merkmale und Eigenschaften der Krebszellen |
||
|
Molekularbiologie/Genetik |
Molekulargenetische Analysen von Zellen und Gewebe |
||
|
Radiologie |
Bildgebung, zum Beispiel Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) |
||
|
Anästhesie |
Planung, Durchführung und Überwachung der Narkose bei einer Operation |
||
|
Chirurgie |
Durchführung eines chirurgischen Eingriffs, der bei Gebärmutterkrebs auch umfangreicher ausfallen kann (je nach Stadium) |
||
|
Gynäkologie |
Planung und Durchführung von Krebsbehandlungen, welche die weiblichen Geschlechtsorgane betreffen |
||
|
Onkologie |
Behandlung von Krebserkrankungen, zum Beispiel Chemotherapie, gezielte Therapien |
||
|
Nuklearmedizin |
manche Diagnosemethoden und Behandlungen arbeiten mit radioaktiven Substanzen |
||
|
zur psychischen Unterstützung von Patientinnen, Patienten und Angehörigen |
|||
|
|
wenn die Krebserkrankung weiter fortgeschritten und nicht mehr heilbar ist |
||
|
Krankenpflege |
Unterstützung der Arbeit von Ärztinnen und Ärzten, Versorgung und Pflege von krebskranken Menschen |
||
|
Schmerztherapie |
Zum Beispiel, wenn sich Metastasen gebildet haben, die oft starke Schmerzen verursachen |
||
|
Physiotherapie |
zur Mobilisierung zum Beispiel nach einer Operation, Behandlung von körperlichen Einbußen, Förderung der Beweglichkeit und der körperlichen Aktivität |
||
|
zum Beispiel bei Übergewicht, um ein normales Körpergewicht zu erreichen; zur Vorbeugung einer Mangelernährung bei Krebs |
|||
|
Sozialarbeit |
Beratung zu rechtlichen, beruflichen und sozialen Fragen |
||
|
Seelsorge |
geistliche und spirituelle Begleitung in Krisensituationen |
||
© iStock /Genestro
Tumorkonferenzen und Tumorboards
Tumorkonferenzen oder Tumorboards sind ein wesentliches Element der Vernetzung und Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team. Sie sind ein fester Bestandteil und in zertifizierten Krebszentren und onkologischen Spitzenzentren verpflichtend. In den Tumorkonferenzen geschieht in der Regel Folgendes:
- Medizinische Spezialistinnen und Spezialisten verschiedener Fachrichtungen treffen sich regelmäßig und tauschen sich fachübergreifend über jede Krebspatientin und jeden Krebspatienten aus.
- Ihre persönliche Krankengeschichte wird vorgestellt und gemeinsam besprochen.
- Alle Beteiligten haben sämtliche Informationen vorliegen (zum Beispiel Diagnose, Befunde, bereits durchgeführte Behandlungen) und sind somit auf dem aktuellen Stand. Sie können diese Befunde aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und Ihre Meinung und Einschätzung mit einfließen lassen. So lässt es sich vermeiden, dass eine Ärztin oder ein Arzt alleine über Ihre Behandlung entscheidet, zum Beispiel über eine Chemotherapie.
- Im Team besprechen und diskutieren Fachleute jeden einzelnen Fall. Gemeinsam suchen sie nach der bestmöglichen Behandlungsstrategie, die sich am aktuellen Stand der Medizin ausrichtet.
- Nach der interdisziplinären Besprechung erhalten Sie in einem persönlichen Gespräch einen Therapievorschlag, den das Team miteinander abgestimmt und entwickelt hat. Er basiert in der Regel auf den medizinischen Leitlinien zu einer Krebsart, die das derzeit beste und in medizinischen Studien überprüfte Wissen enthält.
- Das interdisziplinäre Team beobachtet und diskutiert den Verlauf und die Fortschritte der Behandlung. Als Basis dienen die aktuellen Untersuchungsergebnisse. Sie fließen in den weiteren Entscheidungsprozess ein. Schlägt die Krebstherapie zum Beispiel gut an, wird sie weiter fortgeführt – falls nicht, überlegt das interdisziplinäre Team eventuell eine Alternative.
Kann ich selbst an einer Tumorkonferenz teilnehmen?
Manche Kliniken bieten die Möglichkeit, dass Sie selbst an der Tumorkonferenz teilnehmen können. Allerdings tauschen sich Expertinnen und Experten oft in ihrer medizinischen Fachsprache aus, was für Laien in der Regel unverständlich ist. Manche fühlen sich dadurch auch verunsichert und verängstigt statt ermutigt.
Die sogenannte PINTU-Studie (2021) hat untersucht, welche Vor- und Nachteile die Teilnahme von Patientinnen an den Tumorkonferenzen hat. Die Abkürzung „PINTU“ steht für engl. „Patient involvement in multidisciplinary tumor conferences“ oder deutsch: „Patientenbeteiligung bei multidisziplinären Tumorkonferenzen“. Die Mehrheit der Studienteilnehmerinnen hatte Brustkrebs (circa 60 Prozent), ungefähr 14 Prozent waren an einem gynäkologischen Tumor erkrankt und 26 Prozent der Frauen hatte eine Kombination aus Brustkrebs und gynäkologischem Tumor. Im Schnitt waren die Frauen knapp 60 Jahre alt.
Die Studie wollte zum Beispiel herausfinden, ob die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Patientinnen bei den Behandlungsempfehlungen womöglich stärker berücksichtigt werden, ob sie die Teilnahme eher als emotional belastend empfinden und wie sie diese insgesamt bewerten. Die meisten Frauen haben positive Erfahrungen gemacht und fanden die Tumorkonferenzen informativ. 52 Prozent der Frauen konnten anschließend den Verlauf ihrer Krebserkrankung, 63 Prozent die Therapiemöglichkeiten und 64 Prozent die Behandlungsentscheidungen besser verstehen. Manche Frauen waren allerdings auch verunsichert. 19 Prozent hat die Teilnahme Angst gemacht und 15 Prozent waren danach eher verwirrt. Die Teilnahme von Patientinnen und Patienten an einer Tumorkonferenz ist heute noch kein Standard.
- Deutsche Krebsgesellschaft, Multidisziplinäre Tumorkonferenzen in Deutschland, abgerufen am 5.3.2025
- NCT Heidelberg, Behandlung, Tumorboard, abgerufen am 5.3.2025
- Charité Universitätsmedizin Berlin, Interdisziplinäre Tumorkonferenzen, abgerufen am 5.3.2025
- Klinikum Uni Heidelberg, Interdisziplinäre Tumorkonferenz, abgerufen am 6.3.2025
- Ansmann et al. (2021): Patient participation in multidisciplinary tumor conferences: How is it implemented? What is the patients’ role? What are patients’ experiences? Cancer Medicine. DOI: 10.1002/cam4.4213, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cam4.4213
- Gelbe Liste, Sollen Patienten an Tumorkonferenzen teilnehmen?, abgerufen am 6.3.2025
NP-DE-AOU-WCNT-250002 03/25
Die Informationen auf dieser Seite können eine professionelle Beratung durch ausgebildete und anerkannte Ärztinnen und Ärzte nicht ersetzen. Auch dienen sie nicht dazu, eigenständig eine Diagnose zu stellen oder eine Therapie einzuleiten.